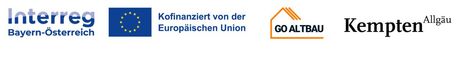Wärmebrücken: Schlecht fürs Konto und den Wohnkomfort
Wärmebrücken – noch nie davon gehört, werden jetzt viele denken. Dabei können Wärmebrücken gravierende Folgen für Gebäude und ihre Bewohner haben, angefangen von höheren Heizkosten, über mangelhaften Wohnkomfort, bis hin zur Schimmelbildung mit entsprechenden Gesundheitsgefahren und langfristigen Bauschäden.
Schwachstelle in der Gebäudehülle
Vereinfacht gesagt, ist eine Wärmebrücke ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme besser leitet und diese schneller nach außen transportiert, als es in den angrenzenden Bauteilen der Fall ist. In der Heizperiode bilden sich an dieser Stelle an der Innenseite der Gebäudehülle kalte Bereiche, an denen sich schlimmstenfalls Feuchtigkeit niederschlägt, was zu Schimmelbildung führen kann. Abgesehen davon sinkt der Komfort angesichts kalter Stellen an den Innenwänden und der Heizenergieverbrauch steigt.
Verschiedene Ursachen
Die Ursachen für Wärmebrücken lassen sich in bauliche, geometrische und materialbedingte Faktoren unterteilen. Konstruktionsbedingte Wärmebrücken entstehen in der Regel beim Einbau von Komponenten, die die thermische Geschlossenheit oder die Dämmung der Gebäudehülle stören. Dazu zählen Balkone, Rollladenkästen, auskragende Stahlträger, Heizkörpernischen oder unzureichend gedämmte Fensterrahmen. Sowohl im Neubau als auch bei Sanierungen sollte in all diesen Fällen darauf geachtet werden, dass keine Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit mit der Außenumgebung in Kontakt kommen oder passende Dämmmaßnahmen vorgenommen werden.
Geometrie und Marterial
Geometrische Wärmebrücken entstehen in Gebäudebereichen, bei denen die Innenoberfläche deutlich kleiner ist als die wärmeableitende Außenoberfläche. Das ist insbesondere bei Außenecken, Erkern, Kanten oder Gauben und ähnlichen Bauformen der Fall. In diesen Bereichen führt ein energetisch ungünstiges Verhältnis zwischen Innen- und Außenoberfläche zur erhöhten Ableitung von Wärme in die Umgebung. Was materialbedingte Wärmebrücken betrifft, führt insbesondere der Einsatz von Beton, Stahl oder anderen guten Wärmeleitern zu Wärmeverlusten. Beispiel ist die betonierte Geschoßdecke, die sich bis ganz an die Außenwand durchzieht.
Planung und Bausführung entscheidend
Wichtig: Viele Wärmebrücken entstehen bereits in der Bauphase und lassen sich durch eine sorgfältige Planung reduzieren. Eine lückenlose Dämmung, der Einsatz hochwertiger Dämmstoffe und eine konsequente thermische Trennung von Bauteilen helfen, Wärmebrücken zu vermeiden. Prinzipiell haben moderne Neubauten dank aktueller Bauvorschriften und besserer Dämmmaterialien in der Regel weniger Wärmebrücken als Bestandsgebäude. Dennoch können auch hier Planungsfehler oder unsachgemäße Ausführungen zu Wärmebrücken führen.
Stoßlüften ist wichtig
Bleibt noch die Frage, wie man mit Wärmebrücken umgeht. Dass eine Wärmebrücke besteht, merkt man manchmal allein schon daran, dass man

einen deutlichen Temperaturunterschied zu den benachbarten Wandflächen spürt, wenn man seine Hand auf die verdächtige Stelle legt. In einem solchen Fall sollte in den betroffenen Räumen noch stärker auf regelmäßiges Stoßlüften geachtet werden, um einer Schimmelbildung vorzubeugen. Das gilt ganz besonders für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit. Zudem sollte die Raumtemperatur von 15 bis 16 Grad Celsius nicht unterschritten werden.
Wärmedämmung als Hilfe
Beseitigen kann man Wärmebrücken in bestehenden Gebäuden mit baulichen Maßnahmen: Eine außen angebrachte Fassadendämmung kann viele Wärmebrücken überdecken und damit beseitigen. Bei anderen Wärmebrücken wie der durchbetonierten Balkonplatte können andere und teilweise auch weitergehende Maßnahmen wie beispielsweise die komplette Erneuerung des Balkons angebracht sein. Meist mit etwas weniger Aufwand verbunden ist die nachträgliche Dämmung von Heizkörpernischen, von Rollladenkästen oder der Einbau einer gedämmten Dachbodentreppe.
Fachleute finden
Sie suchen für Ihr Projekt ein Architektur- und Planungsbüro, einen Handwerksbetrieb oder eine Bau- und Energiefirma mit Qualitätssicherung? Mit den eza!-Partnern finden Sie kompetente Fachleute für Ihr Projekt!
Unser FördermittelCheck zeigt Ihnen die passenden Förderprogramme
Hier finden Sie weitere Energietipps
Sie wollen wissen, wie Sie den Energiebedarf in Ihrem Haus senken oder erneuerbare Energien besser nutzen können? Die gemeinsame Energieberatung von eza! und der Verbraucherzentrale hilft Ihnen weiter.
Zu den Energieberatungsangeboten von eza! und Verbraucherzentrale

Förderung
Unser Online-Angebot zum Thema Gebäudesanierung ist Teil der Grenzüberschreitenden Offensive Altbau (GO Altbau) und wird gefördert durch das INTERREG Programm VI-A Bayern – Österreich 2021-2027 – ein Programm der Europäischen Union. Die Kofinanzierung des Projekts erfolgt durch die Stadt Kempten.