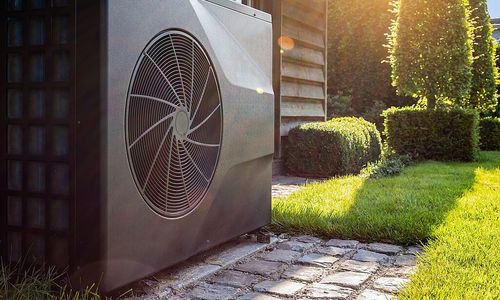Wärmepumpenheizkörper: Der Heizbooster für besondere Fälle
Heizkörper und Wärmepumpe? Ja, das funktioniert. Zahlreiche Praxisbeispiele zeigen, dass mit dieser Kombination Bestandgebäude zuverlässig und kostengünstig mit Wärme versorgt werden können – auch wenn eine Wärmepumpe in Verbindung mit einer Fußboden-, Wand oder Deckenheizung noch effizienter arbeitet, weil hier das Heizsystem mit einer niedrigeren Vorlauftemperatur auskommt. Manchmal kann es allerdings bei der Umstellung auf eine Wärmepumpenheizung notwendig sein, einzelne alte Heizkörper gegen neue und größere auszutauschen. Fehlt der Platz für die Vergrößerung der Heizfläche, gibt es eine Alternative: der Einbau spezieller Wärmepumpenheizkörpern.
Ganz wichtig: Heizlastberechnung
Zu den ersten Schritten beim Umstieg auf eine klimafreundliche Wärmepumpen-Heizung zählt die Heizlastberechnung. Dabei wird die Wärmeleistung ermittelt, die benötigt wird, um ein Gebäude an kalten Tagen auf eine gewünschte Innentemperatur zu bringen und diese zu halten. Aus der Heizlastberechnung lässt sich auch ableiten, ob die vorhandenen Heizkörper ausreichend dimensioniert sind.
Eingebaute Ventilatoren
Ist der Einbau eines größeren Heizkörpers nicht möglich, kommen Wärmepumpenheizkörper ins Spiel. Diese werden auch als Niedertemperaturheizkörper bezeichnet. Sie verfügen über eine Art „Heizbooster“ und zwar in Form von eingebauten Ventilatoren. Diese erhöhen bei Bedarf die Wärmeabgabe, indem sie mehr Luft entlang der Heizflächen blasen. Das sorgt dafür, dass bei gleicher Baugröße niedrigere Vorlauftemperaturen ausreichen, um die Leistung konventioneller Heizkörper zu erreichen.
Auch dafür gibt es Zuschuss
Allerdings sind sie teurer als konventionelles Modelle. Zudem muss der Wärmepumpenheizkörper wegen der Ventilatoren ans Stromnetz angeschlossen werden, was für zusätzliche Kosten sorgt – wobei die Heizkörperumrüstung im Zuge einer Umstellung auf eine Wärmepumpe auch gefördert wird.
Auf Geräuschangaben achten
Wichtig: Ist der Ventilator des Wärmepumpenheizkörpers in Betrieb, verursacht das Geräusche. Allerdings sind inzwischen Wärmepumpenheizkörper auf dem Markt, die äußerst leise arbeiten. Bei der Auswahl gilt es also auf die Geräuschangabe der Hersteller zu achten, die bei eingeschaltetem Ventilator unter einem Wert von 30 Dezibel liegen sollte.
Modelle mit Kühlfunktion
Neben der höheren Heizleistung punkten die Wärmepumpenheizkörper noch auf einem anderen Gebiet: es gibt Modelle, mit denen im Sommer auch gekühlt werden kann, sofern die eingebaute Wärmepumpe dafür geeignet ist. Dabei wird zwischen Wärmepumpenheizkörpern unterscheiden, die eine Klimatisierung mit oder ohne Kondensatbildung ermöglichen. Erstere sorgen für eine schnelle, effiziente Kühlung, was aber voraussetzt, dass das Kondenswasser, das bei der höherer Kühlleistung anfällt, nach außen abgeführt werden kann. Bei einer Klimatisierung ohne Kondensat ist der Kühleffekt niedriger, der Raum wird nur aufgefrischt, was aber dennoch als angenehm empfunden wird. Die Kühlfunktion bietet sich insbesondere an, wenn eine Photovoltaikanlage vorhanden ist. Die Kühlfunktion kann dann an heißen, sonnigen Tagen mit überschüssigem Solarstrom betrieben werden.

Übrigens: es gibt auch sogenannte Heizkörperverstärker, die man sich wie eine kleine Ventilatorleiste vorstellen kann. Die Leiste wird mittels Magnethalterung einfach unten am Heizkörper befestigt und bläst die Luft durch die Bleche und Platten eines klassischen Heizkörpers. Laut Anbieter lässt sich damit der Energieverbrauch um bis zu 20 Prozent senken. Wichtig: Wird eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus über eine zentrale Heizungsanlage versorgt und sind die Heizkörper mit sogenannten Heizkostenverteilern versehen, dürfen Heizkörperventilatoren nicht verwendet werden. Deren Einsatz würde nämlich zum Nachteil der übrigen Nutzer der zentralen Heizungsanlage die Heizkostenabrechnung verfälschen.
Fachleute finden
Sie suchen für Ihr Projekt ein Architektur- und Planungsbüro, einen Handwerksbetrieb oder eine Bau- und Energiefirma mit Qualitätssicherung? Mit den eza!-Partnern finden Sie kompetente Fachleute für Ihr Projekt!
Unser FördermittelCheck zeigt Ihnen die passenden Förderprogramme
Hier finden Sie weitere Energietipps
Sie wollen wissen, wie Sie den Energiebedarf in Ihrem Haus senken oder erneuerbare Energien besser nutzen können? Die gemeinsame Energieberatung von eza! und der Verbraucherzentrale hilft Ihnen weiter.
Zu den Energieberatungsangeboten von eza! und Verbraucherzentrale